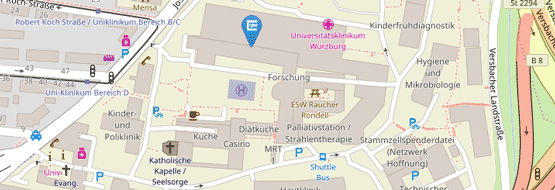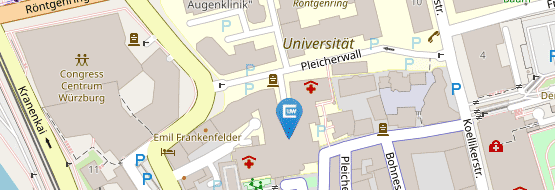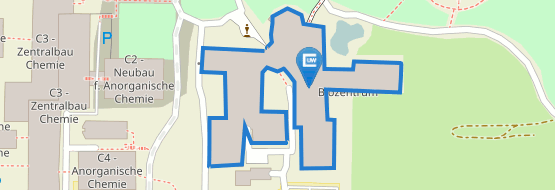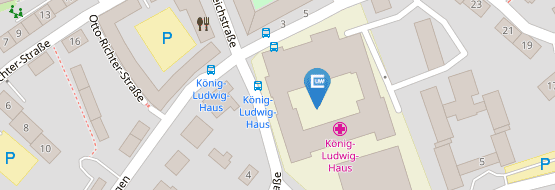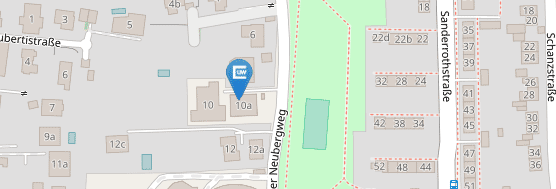Preise für drei junge Forscherinnen
14.10.2025Die Fakultät für Humanwissenschaften hat Dr. Nina Döllinger für ihre Dissertation den Beatrice-Edgell-Preis verliehen. Der Matilda-Preis für die besten Paper ging an Dr. Maria Pfeiffer und Nea Solander.

Den mit 1.000 Euro dotierten Beatrice-Edgell-Preis vergibt die Fakultät für Humanwissenschaften an herausragende Doktorarbeiten von Frauen. Er geht für 2025 an Dr. Nina Döllinger vom Institut Mensch-Computer-Medien.
Nina Döllinger hat in ihrer Dissertation untersucht, wie sich die Wahrnehmung des eigenen Körpers verändert, wenn Menschen in Virtueller Realität (VR) einen Avatar nutzen. Sie entwickelte ein Modell zur Selbst- und Avatar-Wahrnehmung, analysierte bestehende Studien und führte eigene Experimente durch. Ihre Forschung zeigt, wie VR die körperliche und geistige Selbstwahrnehmung beeinflussen kann – mit möglichen Anwendungen in der Therapie, etwa bei Essstörungen. Aus der Arbeit heraus sind sieben wissenschaftliche Veröffentlichungen entstanden. Neben ihrer Promotion engagierte sich Nina Döllinger in der Lehre, der Wissenschaftskommunikation und der akademischen Selbstverwaltung. Aktuell plant sie ein Habilitationsprojekt.
Benannt ist der Preis nach der Britin Beatrice Edgell. Sie war 1901 an der Uni Würzburg die erste Frau, die einen Doktortitel erhielt. Weitere Informationen zum Beatrice-Edgell-Preis.
Matilda-Preis für Maria Pfeiffer und Nea Solander
Die Fakultät vergibt außerdem den Matilda-Preis für die zwei besten Paper von Nachwuchsforscherinnen. Jeder Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.
Der Name des Preises leitet sich vom Matilda-Effekt ab. Dieser beschreibt das Phänomen, dass wissenschaftliche Beiträge von Frauen oft weniger anerkannt werden als die von Männern. Das Phänomen ist nach der Frauenrechtlerin Matilda Joslyn Gage benannt. Weitere Informationen über den Matilda-Preis.
Dr. Maria Pfeiffer vom Institut für Psychologie erhält den Preis für eine wissenschaftliche Arbeit zur Hirnforschung. Sie hat untersucht, wie Menschen durch sogenanntes Neurofeedback lernen können, ihre Hirnaktivität gezielt zu beeinflussen. Das gelingt über eine bestimmte Hirnfrequenz, die mit Aufmerksamkeit und Konzentration zusammenhängt. Die Studie fasst frühere Untersuchungen zusammen und bewertet deren Ergebnisse. Auf dieser Grundlage schlägt Dr. Pfeiffer neue Studien vor. Außerdem entwickelte sie eine einheitliche Sprache, um die Wirkung von Neurofeedback klarer zu beschreiben. Ihre Arbeit hilft dabei, Forschungsergebnisse besser zu vergleichen und neue Studien gezielter zu gestalten.
Nea Solander vom Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und Europaforschung wird für einen Artikel über die Demokratieförderung der EU ausgezeichnet. Darin untersucht sie, wie die EU in ihrer Nachbarschaft Demokratie unterstützt und welche Bereiche sie dabei besonders beeinflusst. Ihre Studie zeigt, dass die EU zwar nicht immer klassische Demokratien fördert, aber gezielt Rechtsstaatlichkeit oder faire Wahlen stärkt. Damit liefert Nea Solander neue Erkenntnisse darüber, wie die EU als globaler Akteur handelt und warum ihre Strategien in bestimmten Bereichen erfolgreich sind. Die Arbeit trägt zur wissenschaftlichen Diskussion über die Rolle der EU in der Welt bei.