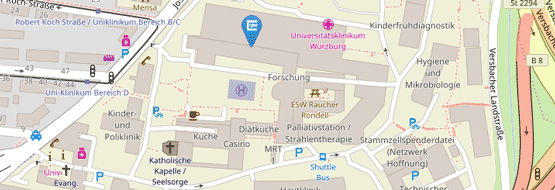Nano-Forschung aus Würzburg für die Umwelt

Der bayerische Umweltminister Marcel Huber gab in München den Startschuss für den Projektverbund "UMWELTnanoTECH". Die Universität Würzburg ist in dem Bündnis zur weiteren Erforschung der Nano-Technologie stark vertreten und erhält knapp eine Million Euro Förderung.
Nanotechnologie wird in der Wissenschaft auf vielfältige Art und Weise erforscht und genutzt. Dabei geht es etwa darum, die Anwendungsmöglichkeiten von neuartigen Materialien zu untersuchen oder aber darum, aus der Natur bekannte Effekte für Wissenschaft und Industrie und Gesellschaft nutzbar zu machen. Ein bekanntes Beispiel ist dabei der Lotusblatt-Effekt: Verschmutzungen können nicht auf der Oberfläche dieser Pflanzen haften – aufgrund einer ganz besonderen, extrem kleinteiligen Struktur der Blätter.
Chancen und Risiken der Nanotechnologie umfassend erforschen
Auch die Farben vieler Libellen oder Schmetterlingsflügel beruhen auf Nanostrukturen, die beispielsweise als Fälschungsschutz für Banknoten eingesetzt werden könnten. Der Name des Verbundes: "UMWELTnanoTECH", steht für "Umweltverträgliche Anwendung der Nanotechnologie". Das erklärte Ziel ist, Chancen und Risiken der Nanotechnologie umfassend zu erforschen. "Es handelt sich dabei primär um Grundlagenforschung, den Anwendungsbezug dürfen wir jedoch auch nicht aus den Augen verlieren", sagt Professor Vladimir Dyakonov von der Uni Würzburg, die mit insgesamt drei von neun Forschungsthemen stark vertreten ist und somit eine wichtige Rolle in dem universitären Verbund einnimmt.
Insgesamt unterstützt der Freistaat Bayern die neun Forschungsthemen und eine Koordinierungsstelle mit knapp drei Millionen Euro. "Nanomaterialien sind ein wichtiges Stück technischer Zukunft. Insbesondere in der Umwelttechnik gibt es viele spannende Anwendungsmöglichkeiten. Wir müssen aber mit den Chancen der Nanotechnologie verantwortungsvoll umgehen", sagte Umweltminister Huber bei der Auftaktveranstaltung, bei der Vertreter der Unis aus Amberg, Bayreuth, Deggendorf, München, Nürnberg und Würzburg anwesend waren.
Drei von neun Projekten in Würzburg angesiedelt
Drei der neun in dem Projektverbund zusammengefassten Vorhaben sind an der Universität Würzburg angesiedelt, womit fast eine Millionen Euro Fördergelder nach Würzburg fließen. "Das zeigt, dass wir in diesem Bereich sehr gut sind", sagt Vladimir Dyakonov. Als Inhaber des Lehrstuhls Experimentelle Physik VI an der Uni Würzburg ist er mit dem Projekt "Umweltverträgliche hocheffiziente organische Solarzellen" dabei.
Dyakonov erforscht in seinem Projekt, wie die Produktion von Solarzellen ohne umweltschädigende Stoffe auskommen kann. "Es geht unter anderem darum, wie wir aus natürlichen Kohlenwasserstoff-Verbindungen Solarzellen herstellen können, ohne etwa giftige Lösungsmittel zu verwenden", erklärt Dyakonov. Dabei liegt der Fokus auf Produkt und Prozess zugleich. Dass die so hergestellten Solarzellen mindestens so effizient wie herkömmlich hergestellte sein sollen, ist ein weiterer Anspruch Dyakonovs.
Solarzellen, Speicher und Nanodiamanten
Ein weiteres Würzburger Projekt wird von Professor Gerhard Sextl vom Lehrstuhl für Chemische Technologie der Materialsynthese geleitet. Es trägt den Titel "Hybridkondensatoren für smart grids und regenerative Energietechnologien".
Dabei geht es um die Entwicklung von umweltverträglichen, hocheffizienten und kostengünstigen Energiespeichern. Diese sollen beispielsweise dabei helfen, Stromschwankungen abzufangen, wie sie witterungsbedingt bei der Stromproduktion durch Windkraft- und Photovoltaikanlagen entstehen können.
Die Arbeiten basieren auf den bekannten Lithium-Ionen-Batterien und elektro-chemischen Doppelschichtkondensatoren. Eine Kombination aus Lithium-Ionen-Batterie (große Speicherfähigkeit) und Doppelschichtkondensator (schnelle Ladung und Entladung), ein so genannter Hybridkondensator, kann die Vorteile beider Speichertypen in sich vereinen. Durch die Anwendung von Verfahren der chemischen Nanotechnologie lassen sich die Eigenschaften von Aktivkohlenstoffen und der Batteriematerialien so kombinieren, dass schnelle Energiespeicher mit hoher Speicherdichte daraus resultieren.
Das Würzburger Trio komplettiert Professorin Anke Krüger. Sie stellte ihre Forschung in München unter dem Titel "Ultraschnelle elektrische Speicher auf Basis von Nanodiamantkompositen" vor. Krüger untersucht gemeinsam mit dem Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern), inwieweit so genannte Nanodiamanten helfen können, Energiespeicher effizienter zu machen.
Superkondensatoren, so genannte "Supercaps" gelten als Energiespeicher der Zukunft. Sie können elektrische Energie ohne verlustreiche Umwandlungsprozesse innerhalb von Sekunden aufnehmen und abgeben, sind daher etwa bei der Rückgewinnung von Bremsenergie in Fahrzeugen interessant. Der Einbau von Nanodiamanten kann helfen, die Speicherkapazität der Supercaps in Zukunft erheblich zu erhöhen.
Umwelt- und Klimaschutz im Blick
Die neun Projekte sind in drei Themenbereiche gefasst. Anke Krüger ist mit ihrer Arbeit Teil des Bereichs "Energiespeicher", dem Gerhard Sextl als Sprecher vorsteht. Vladimir Dyakonov ist der "Organischen Photovoltaik" zugeordnet und ebenfalls Bereichssprecher. Auch bei den weiteren Themen handelt es sich vor allem um Projekte aus den Bereichen Ressourcen- und Klimaschutz sowie Energiesparen.
"Nanotechnologie kann dazu beitragen, Ressourcen einzusparen und herkömmliche durch umweltschonende Verfahren zu ersetzen", sagt Umweltminister Huber. Dyakonov ergänzt: "Es ist sehr wichtig und eine große Chance, dass wir frühzeitig die Verfahren darauf hin überprüfen können, inwieweit Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit kompatibel sind."
Rohstoffe schonen
Durch winzige Nano-Strukturen könnte auf den großflächigen Einsatz ressourcenintensiver Materialen verzichtet werden, Rohstoffe würden geschont. Dyakonovs Solarzellen könnten auf andere Materialien aufgedruckt werden, nur 100 Nanometer dick.
Auch der Klimaschutz spielt eine wichtige Rolle. So könnte es sein, dass durch eine effektivere Nutzung von Abwärme Treibhausgas-Emissionen weiter reduziert werden. Die Forschungsprojekte befassen sich dazu auch mit Oberflächenstrukturen von Thermogeneratoren, die Restwärme in elektrische Energie umwandeln.
Unter dem Begriff Nanotechnologie werden alle Verfahren und Anwendungsbereiche verstanden, bei denen die neuartigen funktionalen Strukturen eine Größe von unter 100 Nanometern haben. Ein Nanometer entspricht einem Milliardstel Meter. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist rund 80.000 Nanometer dick.
Kontakt und Informationen:
Website des Verbunds:
www.umwelt-nanotech.de
Ansprechpartner Uni Würzburg:
Prof. Dr. Vladimir Dyakonov, T.: (0931) 31 83111