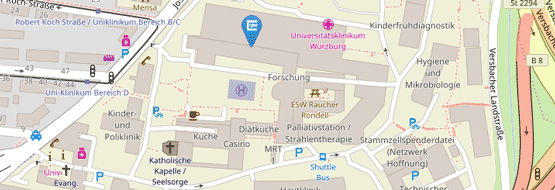Klima, Energie und Schulden

Die Politik hat die Energiewende beschlossen – und eine Schuldenbremse. Geht das zusammen? Vier Wissenschaftler hielten dazu Vorträge im Toscanasaal der Würzburger Residenz. In die gewohnte Krisenrhetorik stimmten die Redner aber nicht ein. Der Grundton blieb überraschend optimistisch.
Gescheiterte Klimagipfel, steigende Strompreise und klamme Staatskassen: Wie sich Klima-, Energie- und Schuldenpolitik in Deutschland gegenseitig bedingen, erklärten Experten an zwei Abenden im Rahmen einer Veranstaltung der Universität Würzburg. Unter dem Thema „Energiewende, Klimaschutz, Schuldenbremse: Schafft Deutschland das?“ trugen vier Wissenschaftler am vergangenen Donnerstag und Freitag neue Erkenntnisse und Zukunftsszenarien vor.
Für den Auftakt sorgten der Mathematiker Jürgen Grahl und Physik-Professor Reiner Kümmel. „Jeder Pilot weiß, dass man nicht erst am Ende der Landebahn bremst“, fasst Grahl seine Einschätzung zur Klimaschutz-Debatte zusammen. „Und was machen wir? Wir geben nochmal kräftig Gas.“ Reiner Kümmel sieht das ähnlich. „Eine Weiterführung des Status quo hätte dramatische Folge
Eine Operation am offenen Herzen der Volkswirtschaft
Dieser Entwicklung begegnen soll die „Energiewende“ der Bundesregierung, vor allem durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Durch Strom aus Wasser, Sonne und Wind möchte Deutschland nicht nur umweltfreundlich, sondern auch unabhängiger von ausländischen Energie-Importen werden. Vor 2050 will die Regierung die Treibgas-Emissionen um 80 Prozent reduzieren, und bis 2022 soll auch der Atomausstieg erreicht sein.
Reiner Kümmel, emeritierter Professor für Theoretische Physik und Astrophysik an der Universität Würzburg, sieht dabei allerdings einige Stolpersteine: Er spricht von der Energiewende als „Operation am offenen Herzen der Volkswirtschaft.“ Vor allem die beschlossene Schuldenbremse macht ihm Sorgen. Sie könne einer Finanzierung der dringenden Energiewende im Wege stehen. „So, wie die Wiedervereinigung, können wir die Energiewende nicht finanzieren“, konstatiert er. Ein noch größeres Problem sieht der Physiker beim Wähler - genauer gesagt bei Anwohnern, die zwar nicht erneuerbare Energien an sich, aber das Windrad vor der eigenen Haustüre ablehnen und so Bauvorhaben blockieren.
Energiewende als Investition in die Zukunft
Jürgen Gral warnt vor einer leichtsinnigen Einschätzung der Klimaproblematik: Den Schutz des Weltklimas als „Last“ anzusehen, münde in fatalen Folgen. „Das führt zu einer Klimaschutz-Diplomatie, die sich höchstens darauf einigt, sich nächstes Jahr wieder zu treffen“, so der Mathematiker. Er selbst stellt ein mutiges Zukunftsmodell vor: „Energie für immer durch 100 Prozent Erneuerbare“ lautet sein Vortrag, in dem er ein Szenario der regenerativen Vollversorgung vorstellt.
Grals Plan setzt vor allem auf Windenergie - etwa 15 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland will er mit Windrädern bebauen lassen. Auf 90 Prozent der freien Dach- und Fassadenflächen soll außerdem Photovoltaik-Technik installiert werden. Insgesamt hält Gral eine erfolgreiche Energiewende für machbar. Statt als Last solle die Energiewende als „Investition in die Zukunft“ begriffen werden, erklärt er am Ende seines Vortrags.
Strommarkt muss europäisch gedacht werden
Am zweiten Veranstaltungstag waren schließlich auswärtige Experten zum Thema geladen: Dietmar Lindenberger vom Energiewirtschaftlichen Institut der Universität Köln stellte die Energieszenarien der Bundesregierung vor. Der Wissenschaftler erzählte dabei auch von der Zusammenarbeit mit Regierung und Behörden. „Von der Politik kommen oft ambitionierte Zielvorgaben, die technische Umsetzung ist aber oft schwieriger als auf dem Papier gedacht“, erklärt er.
Im Hinblick auf erneuerbare Energien fordert der Wissenschaftler ein Umdenken: „Der Strommarkt kann nicht mehr deutsch gedacht werden, er muss europäisch gedacht werden“, erklärt Lindenberger. Das wirke sich auch auf den Bau von Kraftwerken aus. „Solar- und Windkraftwerke müssen also dort gebaut werden, wo die Potenziale am größten sind“, etwa in Südeuropa.
Erneuerbare Energien: Lerneffekte senken die Kosten
Den Abschluss des zweiten Abends bot Thomas Bruckner vom Institut für Infrastrukturforschung und Ressourcenmanagement der Universität Leipzig. Bruckner, der auch dem Weltklimarat IPCC angehört, diskutierte den Sinn von Emissionshandel und die Förderung erneuerbarer Energien. Bruckners Fazit: Beide Instrumente sind wichtig, um eine drohende Klimakatastrophe erfolgreich zu verhindern.
Bruckner sieht große Potenziale für erneuerbare Energien, auch wenn deren Finanzierung bislang schwierig sei. „Die Technik ist momentan noch teuer. Allerdings gibt es Lerneffekte“, erklärt Bruckner. Je mehr Wissen über eine Technik entstehe, desto billiger könne sie produziert werden. Langfristig hätten erneuerbare Energietechniken dadurch auch einen Preisvorteil. Bruckner sieht „dramatische Kostenreduktionen im Bereich der erneuerbaren Energie“.
Kurzfristigkeit von Wirtschaftsinteressen problematisch
Insgesamt geben sich die vier Experten verhalten optimistisch gegenüber den Herausforderungen von Klima- und Energiewandel. Wenn jetzt ernsthaft eingegriffen werde, so der Tenor, könnten die Folgen moderat bleiben. Ein großes Hindernis sehen die Fachmänner fast einhellig in der Dominanz kurzfristiger Wirtschaftsinteressen, die dem langfristig angelegten Klimaschutz im Wege stehen. Hier müssten Volkswirtschaften „ordnungspolitisch eingreifen“, fordert etwa Klimarat-Mitglied Thomas Bruckner in seinem Fazit.
Valentin Niebler