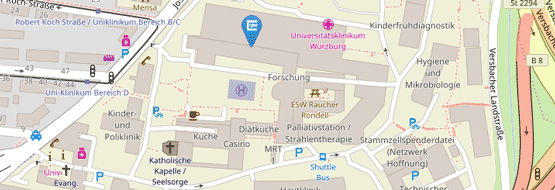Laufende Rotationen

Mundgesundheitsbezogene Lebensqualität bei zahn-, implantat- und zahn-implantat getragenen Rekonstruktionen
Das Interesse an der Lebensqualität im Zuge zahnärztlicher Behandlungen gerät zunehmend in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen. Dabei kann die mundgesundheitsbezogene Lebensqualität (OHRQoL) durch funktionelle Faktoren wie die Kaufähigkeit beeinflusst werden. Darüber hinaus wirken sich subjektive Parameter wie die Ästhetik auf die vorhandene OHRQoL aus. Ein schlecht sitzender oder gar fehlender Zahnersatz kann hierbei zu sozialen Abgrenzungen oder einer eingeschränkten Nahrungsaufnahme führen, was wiederum Auswirkungen auf den allgemeingesundheitlichen Zustand der Patienten haben kann.
Ziel dieses Vorhabens ist es deshalb, die Einflussfaktoren unterschiedlicher zahnärztlicher Interventionen auf die mundgesundheitsbezogene Lebensqualität bei einer großen Anzahl von Patienten (n= 110) mittels des OHIP-G49 Fragebogens zu evaluieren. Hierbei gefundene Zusammenhänge könnten nach kritischer Reflektion eine Anpassung des Behandlungsspektrums mit einer Steigerung der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität ermöglichen und die Patientenversorgung verbessern.
Darüber hinaus soll das Kauvermögen durch ein objektives Messverfahren erfasst werden, wodurch eine Korrelation zwischen Kaufähigkeit und Lebensqualität überprüft werden kann. Zur Erfassung der Lebensqualität von Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren soll zudem ein deutschsprachiger Fragebogen entwickelt und im Zuge prothetischer Versorgung evaluiert werden.
Auch werkstoffkundliche sowie biomechanische Eigenschaften können Einfluss auf die mundgesundheitsbezogene Lebensqualität haben, wobei eine hohe Langlebigkeit und Beständigkeit der Materialien einen Anstieg der Patientenzufriedenheit und im Zuge dessen der Lebensqualität zu ermöglichen scheint. Für eine differenzierte Beurteilung dieser These ist es konsekutiv notwendig, die hervorgebrachten klinischen Ergebnisse in Relation zu in vitro Daten zu setzen.

Einfluss etablierter und experimenteller Pharmaka auf die Diät-induzierte Adipositas mit begleitendem Hypercortisolismus und assoziierte Komorbiditäten im Rattenmodell
Morbide Adipositas und vergesellschaftete Komorbiditäten wie Diabetes mellitus Typ 2, metabolisch-assoziierte Fettlebererkrankung (MASLD) oder kardiovaskuläre Erkrankungen tragen zu einer erheblichen Belastung der Gesundheitssysteme bei. Der Bedarf an neuen effektiven Behandlungsmethoden ist daher groß. Bei adipösen Patienten wird häufig eine Aktivierung der HPA-Achse beobachtet („funktioneller Hypercortisolismus"). Zugleich weist das klinische Bild der primären, multifaktoriellen Adipositas in vielen Fällen erhebliche Überschneidungen mit dem manifesten Hypercortisolismus (Cushing-Syndrom) auf. Im vorliegenden Projekt werden Bioproben eines bereits aktuell laufenden Tierversuchs genutzt, in welchem in männlichen und weiblichen Ratten durch eine Kombination aus einer Hochfettdiät und einer Hemmung der NO-Synthase mittels N-nitro-l-arginine methyl ester (L-NAME) ein (Pseudo-)Hypercortisolismus-Phänotyp erzeugt wurde. Nach Induktion des vorgenannten Phänotyps wurden Tiergruppen unter anderem mit dem GLP-1-Analogon Semaglutid, dem SGLT2-Inhibitor Empagliflozin, PYY3-36, sowie mit Antagonisten des GLP-1 und NPY-2-Rezeptors behandelt. Durch eine genaue molekulare und hormonelle Charakterisierung der HPA-Achse soll im vorliegenden Projekt zunächst eine exakte Phänotypisierung des Tiermodells gelingen. Die Einflüsse der angewandten metabolisch wirksamen Therapien auf den induzierten Hypercortisolismus, die Adipositas und assoziierte Komorbiditäten sollen genauer untersucht werden. Die Experimente sollen zu einem besseren Verständnis des Wirkmechanismus der oben genannten Substanzen im Kontext von Adipositas mit Hypercortisolismus beitragen.

Neuartige adhäsive mineralorganische Zemente aus Organophosphaten und Magnesiumphosphaten bzw. -oxiden in der Medizin sowie Zahnmedizin
Obwohl Knochenkleber in vielen chirurgischen Situationen sinnvoll wären, konnte sich bislang noch kein Knochenadhäsiv in der klinischen Anwendung etablieren. In jüngster Vergangenheit haben mit Phosphoserin modifizierte Calcium-basierte Zemente an Aufmerksamkeit gewonnen. In eigener Arbeit wurden erstmals adhäsive mineralorganische Knochenzemente auf der Basis von Phosphoserin und Magnesiumverbindungen beschrieben. Sie zeigen eine Haftfestigkeit auf Knochen, welche allen bislang bekannten Knochenadhäsiven deutlich überlegen ist. Die Stoffgruppe der Zemente erscheint als Knochenklebstoff generell günstig. Calciumphosphate sind als Knochenersatzmaterialien bereits lange bekannt und besitzen das Potential, vom Körper durch Knochen ersetzt zu werden. Inzwischen weiß man, dass die vergleichsweise unerforschten Magnesium-basierten Zemente diesen in Bezug auf mechanische und biologische Eigenschaften in nichts nachstehen. Nach Kenntnis des Autors wurde in der oben genannten eigenen Arbeit zum ersten Mal überhaupt die Verbindung zwischen Magnesium und Phosphoserin im Kontext eines Zementes beschrieben. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine noch undefinierte Materialgruppe mit Zementeigenschaften. Aufgrund der besonderen Affinität des Magnesiums zu Sauerstoff kommen auch andere Organophosphate wie etwa die Phytinsäure als Reaktanten in Betracht. Ziel des Forschungsvorhabens ist es, adhäsive resorbierbare mineralorganische Zemente auf Basis von Magnesiumverbindungen und Organophosphaten zu etablieren. Dies beschränkt sich nicht nur auf die Anwendung als Knochenklebstoff, sondern ist vielmehr als neuartige Materialgruppe und Plattform zu sehen, aus welcher eine Vielzahl neuer medizinischer und zahnmedizinischer Arbeitsmaterialien hervorgehen kann.
Zukunft der PSMA-PET beim Prostatakarzinom: Neue Auswerte-Strategien für ein personalisiertes Therapiemanagement
Die PSMA-PET ist ein zentraler Baustein in der Diagnostik und Therapieplanung des Prostatakarzinoms. Ziel des geplanten Projekts ist die systematische Evaluation der PSMA-PET anhand verschiedener klinischer Anwendungssituationen durch prospektive und retrospektive Analysen. Im prospektiven Studienteil soll bei Patienten mit einem biochemischem Rezidiv untersucht werden, ob die Bildgebung mit einer Ganzkörper-PET (unter Einbeziehung der Schädelkalotte und der langen Röhrenknochen) im Vergleich zur Teilkörper-PET mit reduzierter Bildakquisition relevante Zusatzbefunde liefert, und deren Einfluss auf das therapeutische Entscheidungsmanagement analysiert werden. Zudem sollen laborchemische Parameter erhoben und hinsichtlich ihrer prognostischen Bedeutung analysiert werden. Im retrospektiven Teil sollen Patientendaten aus der klinischen Routine zusammengetragen und ausgewertet werden. Es soll untersucht werden, ob die PSMA-PET im Primärstaging bei High- und Intermediate-risk Patienten zu Änderungen im Therapiekonzept geführt hat. Zusätzlich soll bei Patienten, die eine PSMA-gerichtete Radioligandentherapie erhalten haben, das Metastasierungsmuster in der prätherapeutischen Bildgebung analysiert werden, um potenziell prädiktive Merkmale für das Therapieansprechen zu identifizieren. Abschließend soll die klinische Anwendbarkeit der RECIP-Kriterien evaluiert werden, wobei ein Vergleich zwischen visueller Beurteilung und einer vereinfachten Keyhole-Methode erfolgen soll. Ziel ist die Etablierung praktikabler und zuverlässiger Methoden zur Therapiekontrolle in der klinischen Routine. Die Ergebnisse sollen eine differenzierte und personalisierte Anwendung der PSMA-PET ermöglichen und damit zur besseren Versorgung von Patienten mit Prostatakarzinom beitragen.

Der Nozizeptor TRPV1 ist ein vielversprechendes Target zur günstigen Beeinflussung der perioperativen systemischen Inflammation und Organdysfunktion
PatientInnen zeigen nach einer Operation häufig Organdysfunktionen. Der mit der Operation notgedrungene Integritätsverlust von Geweben und Zellen setzt „Gefahr-assoziierte molekulare Strukturen“ (DAMPs) frei, die potente Aktivatoren des angeborenen Immunsystems sind. Eine so entstehende systemische Inflammationsreaktion, vor allem die Aktivierung von neutrophilen Granulozyten, aktivieren das Endothel und führen zu einer Störung der vaskulären Barriere und der Mikrozirkulation, was o.g. Organschäden kritisch mit bedingt. Strategien zur Modulation perioperativer Inflammation sind jedoch nicht verfügbar. Der Transient Rezeptor Potential Vanilloid 1 (TRPV1) ist ein Schmerzrezeptor, der auch im Knochenmark exprimiert ist. Durch Modulation der Aktivität des TRPV1 kann die Immunantwort im Rahmen einer Infektion günstig beeinflusst werden. Im Rahmen der Etablierung eines operativen Modells in der Maus konnte ich nun zeigen, dass ein abdominalchirurgischer Eingriff mit einem Ausschwemmen von unreifen, aktivierten neutrophilen Granulozyten in die Blutbahn einhergeht. Mäuse mit trpv1-Defizienz zeigten diese Befunde nicht und waren vor einer Aktivierung der endothelialen Genexpression in der systemischen Inflammation geschützt. Ich möchte nun den Einfluss einer TRPV1-vermittelten Aktivierung durch DAMPs auf die Signalwege in neutrophilen Granulozyten systematisch analysieren und deren Phänotyp und Funktion in trpv1-/- Mäusen und Mäusen mit einer C-terminalen TRPV1-Variante zum Wildtyptier vergleichen. Diese Befunde möchte ich mit dem Genexpressionsprofil sowie der Funktion der Vaskulatur in Beziehung setzen und dem Auftreten von Organschäden im operativen Mausmodell korrelieren. Mein Ziel ist, den TRPV1 als neues Target zur perioperativen Organprotektion zu identifizieren.